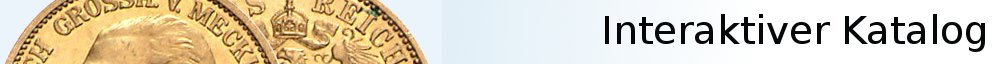Herzog Johann Albrecht I. (1547-1576)
Johann Albrecht I., Herzog zu Mecklenburg
(*23. Dezember 1525, reg. ab 05. Januar 1547, † 12. Februar 1576)
Bitte auf die Münze klicken, um mehr zu erfahren.
- Details
- Kategorie: Herzog Johann Albrecht I. (1547-1576)
|
||||||
| H e r z o g t u m M e c k l e n b u r g | ||||||
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | ||||||
| Wissenswertes | ||||||
|
Kunzel 97 G/a (Avers) vergrößert
Kunzel 97 G/a (Revers) vergrößert |
Taler |
Der Taler geht zurück auf die Idee des Erzherzogs Sigismund "des Münzreichen", den Wert des Goldguldens in einer Silbermünze zu prägen. 1486 prägte er den ersten silbernen Guldiner. Bald prägten auch andere Münzherren solche großen Silbermünzen: Bern, Sitten, Solothurn, Hessen, Salzburg usw. Die ersten Guldiner, die in größerer Menge geprägt wurden, waren die sächsischen Guldengroschen ab 1500, heute "Klappmützentaler" genannt wegen der Kopfbedeckungen, die die drei dargestellten Herzöge tragen. Die größte Bedeutung jedoch gewann der Guldiner, den die Grafen Schlick ab 1520 aus dem Silber ihrer Bergwerke in Joachimstal in Böhmen prägen ließen. An der Südseite des Erzgebirges bei Joachimstal waren um 1512 Silbervorkommen entdeckt worden in einem Gebiet, das Pfandbesitz der Grafen von Schlick war. 1515 begann man mit dem Abbau des Silbers. 1520 wurde den Grafen Schlick von der böhmischen Landschaft (d. h. der Versammlung der landständischen Adeligen) das Münzrecht bestätigt, und sie begannen mit der Prägung. Geprägt wurden Guldengroschen nach sächsischem Münzfuß. Für die Zeit 1520 bis April 1528 hat man eine Ausprägung von mindestens 2.200.000 Stück errechnet; die "Joachimstaler Guldengroschen" verbreiteten sich weithin, und aus der Abkürzung entstand das Wort "Taler". (Numispedia) |
||||
|
|
||||||
|
|
||||||
- Details
- Kategorie: Herzog Johann Albrecht I. (1547-1576)
|
||||||||
| H e r z o g t u m M e c k l e n b u r g | ||||||||
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | ||||||||
| Wissenswertes | ||||||||
|
Kunzel 96 A/a (Avers) vergrößert
Kunzel 96 A/a (Revers) vergrößert |
Taler |
Der Taler geht zurück auf die Idee des Erzherzogs Sigismund "des Münzreichen", den Wert des Goldguldens in einer Silbermünze zu prägen. 1486 prägte er den ersten silbernen Guldiner. Bald prägten auch andere Münzherren solche großen Silbermünzen: Bern, Sitten, Solothurn, Hessen, Salzburg usw. Die ersten Guldiner, die in größerer Menge geprägt wurden, waren die sächsischen Guldengroschen ab 1500, heute "Klappmützentaler" genannt wegen der Kopfbedeckungen, die die drei dargestellten Herzöge tragen. Die größte Bedeutung jedoch gewann der Guldiner, den die Grafen Schlick ab 1520 aus dem Silber ihrer Bergwerke in Joachimstal in Böhmen prägen ließen. An der Südseite des Erzgebirges bei Joachimstal waren um 1512 Silbervorkommen entdeckt worden in einem Gebiet, das Pfandbesitz der Grafen von Schlick war. 1515 begann man mit dem Abbau des Silbers. 1520 wurde den Grafen Schlick von der böhmischen Landschaft (d. h. der Versammlung der landständischen Adeligen) das Münzrecht bestätigt, und sie begannen mit der Prägung. Geprägt wurden Guldengroschen nach sächsischem Münzfuß. Für die Zeit 1520 bis April 1528 hat man eine Ausprägung von mindestens 2.200.000 Stück errechnet; die "Joachimstaler Guldengroschen" verbreiteten sich weithin, und aus der Abkürzung entstand das Wort "Taler". (Numispedia) |
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
- Details
- Kategorie: Herzog Johann Albrecht I. (1547-1576)
| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog |
|
Kunzel 95 B/b (Avers) |
H e r z o g t u m M e c k l e n b u r g |
|
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
||
| Katalogisierung | ||
| Kunzel1: | 95 | |
| Evers21: | 74,2-4 | |
| Vorkommen | ||
|
Kunzel 95 B/b (Revers) |
Öffentliche Sammlungen: | Schwerin, |
| Private Sammlungen: | Beste32: -- | |
| Gaettens6: 164, 165 |
||
| Hannemann7: 3030 | ||
| Hauer20: 127 | ||
| Pelzer18: 114, 115 | ||
| Roeper54: 143 | ||
| SBV 976: -- | ||
| SBV 1943: 1058, 1059 | ||
| Weyl77:125 | ||
| Wruck75: 352 | ||
| Bewertung | ||
| Auktionshaus | Katalog-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro |
| Künker |
314 / 09.10.2018 |
4029 | s - ss |
1.000,00 (B/c) |
| Olding | Lagerliste 111 / 01-2020 | 119 | ss | 2.650,00 (A/a) |
| Künker | 363 / 24.03.2022 | 2916 | kl. Randfehler, ss | 1.700,00 (B/b) |
| Numisbalt | 12.05.2024 | 113 | -- | 4.500,00 (B/c) |
- Details
- Kategorie: Herzog Johann Albrecht I. (1547-1576)
|
||||||||
| H e r z o g t u m M e c k l e n b u r g | ||||||||
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | ||||||||
| Kommentar | ||||||||
| Johann Albrecht I., Herzog von Mecklenburg |
||||||||
|
Johann Albrecht I.
Original vermutlich von Peter van Boeckel
(niederländischer Maler und Kartograf)
|
|
Johann Albrecht I., Herzog zu Mecklenburg, in älterer Literatur auch Johann oder Johannes (* 23. Dezember 1525 in Güstrow; † 12. Februar 1576 in Schwerin), war regierender Herzog zu Mecklenburg im Landesteil Mecklenburg-Güstrow von 1547 bis 1556 und im Landesteil Mecklenburg-Schwerin von 1556 bis 1576. 1549 setzte Johann Albrecht I. auf dem Landtag die Reformation für den Gesamtstaat Mecklenburg durch.
Johann Albrecht war der älteste Sohn des Herzogs Albrechts VII. zu Mecklenburg [-Güstrow] und dessen Gemahlin Anna von Brandenburg. Seine Eltern ließen Johann Albrecht bis zu seinem 13. Lebensjahr durch den „papistischen Vikar“ Johannes Sperling ausbilden. Dann schickte sein Vater ihn 1539 an den Hof seines Schwagers, des protestantischen Kurfürsten Joachim II. von Brandenburg. Gemeinsam mit dem ältesten Sohn des Kurfürsten, Johann Georg, besuchte er von 1541 bis 1544 die neu gegründete Universität in Frankfurt an der Oder. Er kehrte als überzeugter Anhänger des Protestantismus nach Mecklenburg zurück. Auf Wunsch seines Vaters kämpfte er jedoch auf der kaiserlichen Seite im Schmalkaldischen Krieg.
Nach dem Tode seines Vaters im Jahre 1547 wurde er – gemeinschaftlich mit seinen Brüdern Ulrich und Georg – von Kaiser Karl V. mit dem Herzogtum belehnt. Er verwaltete den Güstrower Landesteil vorerst alleine, da sein Bruder Ulrich 1550 als Nachfolger seines Vetters Magnus III. Administrator des Bistums Schwerin wurde und sein Bruder Georg im Schmalkaldischen Krieg kämpfte und 1552 vor Frankfurt am Main fiel.
|
||||||
| Am 24. Februar 1555 vermählte er sich mit Anna Sophie von Preußen (* 11. Juni 1527; † 6. Februar 1591), der Tochter Herzogs Albrechts von Preußen. Das Paar hatte drei Kinder. |
||||||||
| Herzog Johann Albrecht galt als Mäzen von Kunst und Wissenschaft und als moderner Renaissancefürst, der wissenschaftlichen Erkenntnissen seiner Zeit aufgeschlossen gegenüberstand. Zu seinen wichtigen Leistungen gehört die Gründung mehrerer höherer Schulen in Güstrow (Domschule 1552), in Schwerin (Fridericianum 1553) und in Parchim (1564) | ||||||||
| In seinem Testament legte er das Primogeniturrecht fest, um einer Landesteilung vorzubeugen. Johann Albrecht I. starb im 50. Lebensjahr und wurde im Dom zu Schwerin beigesetzt. (Wikiedia) | ||||||||
|
|
||||||||
- Details
- Kategorie: Herzog Johann Albrecht I. (1547-1576)
|
||||||
| H e r z o g t u m M e c k l e n b u r g | ||||||
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | ||||||
| Kommentar | ||||||
| Johann Albrecht I., Herzog zu Mecklenburg |
||||||
|
Johann Albrecht I.
Original vermutlich von Peter van Boeckel
(niederländischer Maler und Kartograf)
|
|
Johann Albrecht I., Herzog zu Mecklenburg, in älterer Literatur auch Johann oder Johannes (* 23. Dezember 1525 in Güstrow; † 12. Februar 1576 in Schwerin), war regierender Herzog zu Mecklenburg im Landesteil Mecklenburg-Güstrow von 1547 bis 1556 und im Landesteil Mecklenburg-Schwerin von 1556 bis 1576. 1549 setzte Johann Albrecht I. auf dem Landtag die Reformation für den Gesamtstaat Mecklenburg durch. Johann Albrecht war der älteste Sohn des Herzogs Albrechts VII. zu Mecklenburg [-Güstrow] und dessen Gemahlin Anna von Brandenburg. Seine Eltern ließen Johann Albrecht bis zu seinem 13. Lebensjahr durch den „papistischen Vikar“ Johannes Sperling ausbilden. Dann schickte sein Vater ihn 1539 an den Hof seines Schwagers, des protestantischen Kurfürsten Joachim II. von Brandenburg. Gemeinsam mit dem ältesten Sohn des Kurfürsten, Johann Georg, besuchte er von 1541 bis 1544 die neu gegründete Universität in Frankfurt an der Oder. Er kehrte als überzeugter Anhänger des Protestantismus nach Mecklenburg zurück. Auf Wunsch seines Vaters kämpfte er jedoch auf der kaiserlichen Seite im Schmalkaldischen Krieg. Nach dem Tode seines Vaters im Jahre 1547 wurde er – gemeinschaftlich mit seinen Brüdern Ulrich und Georg – von Kaiser Karl V. mit dem Herzogtum belehnt. Er verwaltete den Güstrower Landesteil vorerst alleine, da sein Bruder Ulrich 1550 als Nachfolger seines Vetters Magnus III. Administrator des Bistums Schwerin wurde und sein Bruder Georg im Schmalkaldischen Krieg kämpfte und 1552 vor Frankfurt am Main fiel. |
||||
| Am 24. Februar 1555 vermählte er sich mit Anna Sophie von Preußen (* 11. Juni 1527; † 6. Februar 1591), der Tochter Herzogs Albrechts von Preußen. Das Paar hatte drei Kinder. |
||||||
| Herzog Johann Albrecht galt als Mäzen von Kunst und Wissenschaft und als moderner Renaissancefürst, der wissenschaftlichen Erkenntnissen seiner Zeit aufgeschlossen gegenüberstand. Zu seinen wichtigen Leistungen gehört die Gründung mehrerer höherer Schulen in Güstrow (Domschule 1552), in Schwerin (Fridericianum 1553) und in Parchim (1564) | ||||||
| In seinem Testament legte er das Primogeniturrecht fest, um einer Landesteilung vorzubeugen. Johann Albrecht I. starb im 50. Lebensjahr und wurde im Dom zu Schwerin beigesetzt. | ||||||
| (Wikipedia) | ||||||
|
|
||||||